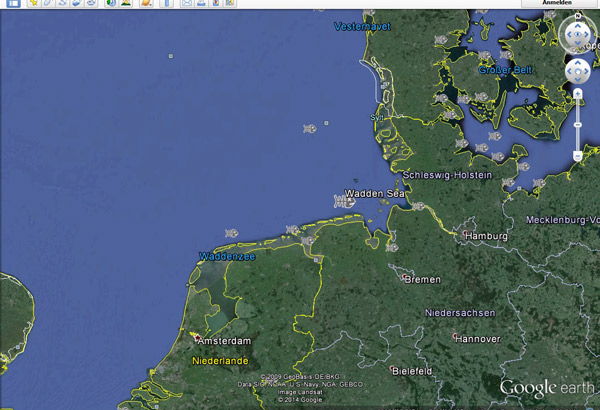![Eilert-Voß, Foto (C) Wattenrat Ostfriesland]()
Eilert Voß in seiner "Stellung" am NSG "Petkumer Deichvorland" an der Ems
Heute, am 05. November 2014, bekommt unser Mitstreiter Eilert Voß in einer Feierstunde in Hannover den Preis der Karl Kaus-Stiftung für seine Verdienste um den Tier- und Naturschutz.
Lieber Eilert, auch auf diesem Wege einen herzlichen Glückwunsch. Und was wären die Wattenrat-Seiten ohne Deine Bilder!
dpa-Redakteur Hans-Christian Wöste hat eine schöne Würdigung geschrieben, die wir nachstehend mit freundlicher Genehmigung der dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH, Hamburg, www.dpa.de veröffentlichen. Eilert Voß´ Dankesrede anlässlich der Preisverleihung können Sie ganz unten nachlesen.
dpa, 04. November 2014:
Beharrlich und unbequem – Umweltaktivist bekommt Naturschutzpreis
Von Hans-Christian Wöste, dpa
Emden/Bremen (dpa/lni) – Beschimpft, bedroht, verletzt und verklagt: In 45 Jahren als Naturschützer hat Eilert Voß einiges erlebt. Bei seinem gewaltfreien Kampf gegen die Jagd im Wattenmeer wurde der Emder nicht nur verbal attackiert. 1989 verliert er beinahe ein Auge, als er vom Steinwurf eines Jägers getroffen wird. Als unbequemer Beobachter von umstrittenen Jagdszenen in einem Naturschutzgebiet wird Voß Jahre später wegen Jagdstörung angezeigt und zu einer Geldstrafe verurteilt. Doch er gibt nicht auf.
In diesen Tagen besetzt der Ostfriese wieder frühmorgens seinen Ausguck an der Ems. Für die Initiative Gänsewacht zum Schutz von jagdbedrohten Vögeln dokumentiert er mit Laptop und Kamera Verstöße der Waidmänner. Das sind Schüsse bei schlechter Sicht wie Nebel, Schneetreiben oder Dunkelheit, wenn geschützte Vogelarten nicht mehr erkennbar sind. Wie Voß fordert auch der Ökologische Jagdverband ÖJV das Verbot der Zugvogeljagd in Schutzgebieten an der Küste.
Für seine Beharrlichkeit wird Voß am Mittwoch von der Bremer Karl Kaus-Stiftung ausgezeichnet. Der mit 5000 Euro dotierte Preis wird für besondere Verdienste beim Schutz freilebender Tiere verliehen. Erster Preisträger war 1982 der renommierte Tierfilmer und Journalist Horst Stern. «Voß bekommt den Preis für seinen Mut. Er nimmt es auch mit der mächtigen und gut organisierten Jagdlobby auf», begründet Joachim Seitz von der Bremer Stiftung die Preisvergabe. Selbst Gerichtsprozesse hätten Voß nicht abgehalten, die Zugvogeljagd an der Küste zu kritisieren und ihr Verbot zu fordern. «Viele reden viel und tun wenig – Eilert Voß macht es umgekehrt», sagt Seitz.
Dabei hatte Voß ganz harmlos mit der Tierfotografie angefangen. Mit 22 Jahren näht er sich ein Tarnzelt, beobachtet daraus stundenlang Kampfläufer und Birkhühner und beginnt seine Sammlung eindrucksvoller Tierfotos. «Niemals hätte ich daran gedacht, eine Jägerprüfung zu machen und diese wundervollen Geschöpfe ins Jenseits zu befördern»,sagt der 66-Jährige im Rückblick. «Das waren Lehrstunden fürs Leben.»
Als Aktivist für den Naturschutz und Kämpfer gegen Umweltzerstörung macht sich Voß seitdem einen Namen über Ostfriesland hinaus. Im Widerstand gegen das umstrittene Dollarthafen-Projekt an der Emsmündung besetzt er 1981 mit niederländischen Umweltschützern eine selbstgebaute Protestplattform im Watt. 1986 demonstriert er beim Festakt zur Eröffnung des Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer gegen die Wattenjagd – an seiner Seite eine als Jäger «Bruno» verkleidete Schaufensterpuppe.
Neben der Gänsewacht ist Voß auch im Wattenrat Ostfriesland aktiv, in dem sich verbandsunabhängige Naturschützer engagieren. Der Vater von zwei Söhnen setzt sich zudem für die Ems ein, die als Folge von Ausbaggerungen zunehmend verschlickt und biologisch verödet. Der Segler kennt das Flussrevier genau und geht dort mit eigenem Boot auf Fotopirsch. Touristische Motive hat er dabei nicht im Blick: «Ich mache aus den Fotos kein Geschäft, sondern setze sie als Waffe gegen die Schande der Landschaftsvernichtung ein.»
Enttäuscht ist Voß von der rot-grünen Landesregierung, die mit einer neue Jagdzeitenverordnung kaum Schutz für die empfindlichen Gebiete erreicht habe. «Er hat also noch genug zu tun», sagt Stiftungsvorstand Seitz.
Dankesrede von Eilert Voß
Verehrtes Stiftungskomitee der Karl Kaus Stiftung für Tier und Natur
Sehr geehrte Damen und Herren hier im Saal.
Da klingelt vor 8 Monaten das Telefon und eine freundliche Stimme spricht ins überraschte Ohr, ich solle von der „Karl Kaus Stiftung“ einen Umweltpreis erhalten!
Ja- da war ich sprachlos und begriff erst im Lauf des Gesprächs, was sich da außerhalb Ostfrieslands in öffentlicher Wahrnehmung anbahnt. Auf meine Frage, wieso man mich denn ehren wolle da ich meine Arbeit lieber im Verborgen als im öffentlichen Rampenlicht tue, sagte man mir: „Sie bekommen den Preis für ihre Beharrlichkeit und vor allem für den Mut, es mit der gut vernetzten Jagdlobby aufzunehmen. Sich nicht einmal durch Gerichtsprozesse vom Ziel abbringen zu lassen, die Zugvogeljagd an der Küste öffentlich zu kritisieren und deren Verbot zu fordern“.
Gut- ich sagte zu, ohne unmittelbar danach die bange Frage hinterher zu schieben: „Da kommt doch etwa kein großer Rummel auf mich zu? Womöglich gar das Fernsehen?“ Als Herr Seitz mir dann versprach: „Nee, geplant ist ne Feier im kleinen Kreis“, – hatten sich meine Bedenken schon fast verflüchtigt.
Da hatte ich also spontan zugesagt, vernahm so ganz schwach etwas von einem stattlichen Preisgeld für die Arbeit in Wattenrat und Gänsewacht und war beinahe selbst erschrocken über mich selbst und die soeben gehörte Würdigung. Langsam spürte ich wieder Boden unter den Füßen.
Im Gestrüpp des Behördendschungels hab ich Verständnis, von Lob ganz zu schweigen, immer vermisst. Kurz flackerte ein Gedankenblitz durch meinen Kopf, dass sich so oder ähnlich Menschen fühlen könnten, denen man übers Telefon sagt:„SIE haben den ´alternativen Nobelpreis` bekommen“.
Dann schaltete ich erstmal den PC an, googelte die bisherigen Preisträger der Stiftung und erschrak ein weiteres Mal: Horst Stern, mein hoch geschätzter Vordenker und Mentor bekam den allerersten Preis! O Gott, was nun? Horst Stern setzt schier unerreichbare Maßstäbe. Reichen meinerseits 200 Jahre Aktivität von heute gerechnet, an Ostfrieslands Naturschutz-Front? Oder sind`s gar satte 300? Seine Filme und vor allem der entlarvende, jagdkritische Film von 1971, zur besten Sendezeit am Weihnachtstag: „Bemerkungen über den Rothirsch!“
„Das wars!“ Eine bestens recherchierte Story, eine Parabel für den Kampf gegen das Heer der rücksichtslosen Lizenzjäger im Watt! Mir als 23 Jährigem zeigte mein verehrter Horst Stern im Fernsehen, dass nur schonungslose Bildreportagen Menschen aufrütteln und dass Langzeiterfolge vor allem mit zäher Aufklärungsarbeit verknüpft sind. Also ran an die Arbeit, es gibt viel zu tun an der Küste. Dass nach dem Film von Horst Stern weitere 43 Jahre mit unendlichem Tierleid ins Land gehen, auch aktuell kein Ende der Fahnenstange in Sicht, ist ärgerlich und ernüchternd zugleich. Über ellenlange Roten Listen, Umwelt- und Naturschutz Lobreden oder geflügelte Worte wie: Bewahrung dser Schöpfung, wird mit Verlaub, oft nur geschwafelt und die Lösung vieler drängender Fragen auf die lange Bank geschoben.
Über viele Jahrzehnte ein ungezügeltes Wirtschaftswachstum, trotz des anklagenden Reports: „Die Grenzen des Wachstums“. In meine Gedankenwelt schlug die Computer-Hochrechnung wie eine Bombe ein. Dennoch sah ich mich, mit bescheidenen Möglichkeiten zwar, herausgefordert.Fest überzeugt, zumindest der regionalen Umweltzerstörung nicht tatenlos zuzusehen und hier und da Widerstand zu leisten.
Da ich als Kind und Jugendlicher schon immer in der Wildnis der Unterems und des Hammrichs umher schlich, lag es nahe, dass ich irgendwann mit der Tierfotografie begann, ein Tarnzelt nähte und stundenlang den Kampfläufern und Birkhühnern bei der Balz zusah. Aus einem Abstand von nur 5 Metern. Und nachts schon mal rein in die Bude- und kalt war`s, weil es fror. Dies waren unvergessliche Lehrstunden fürs Leben. Niemals wäre ich später auf den Gedanken gekommen, eine Jägerprüfung zu machen und mit einer Knarre und viel Radau solch phantastische Geschöpfe ins Jenseits zu befördern oder eine Gans in der Luft zu beschießen.
Oft bemerkte ich in Gegenden meiner Fotografierversuche Monate später, dass man die betreffenden Landschaften umkrempelte. Da war die Orchideenwiese ein Acker, der Teich zugeschüttet, oder das Flussufer nicht mehr natürlich, sondern in ein Steinkorsett gezwängt. Vollendete Tatsachen!
Begleitet wurden all die Umweltverbrechen von Lobreden der Profiteure in den Medien. Man vergab an Verantwortliche der Überspülung meines Hammrichs mit giftigem Schlick aus dem Emder Hafen, ein Bundesverdienstkreuz! Welch ein Hohn!
Ich begann, der verdrängten Natur wenigstens in Leserbriefen Nachrufe zu widmen, mich mit Gleichgesinnten zu organisieren und hier und da den unzähligen Tätern am regionalen Artensterben zu zeigen, dass deren Tun längst erkannt ist. In 45 Jahren entstand ein fotografisches Geschichtsarchiv mit 100.000 Dias und modernen Digitalbildern vom Tüpfelsumpfhuhn bis zum Gülle spritzenden Bauern, der in einer Schneelandschaft Nonnengänse vertrieb und mich nach der Aufnahme eine ganze Stunde mit seinem Auto verfolgte. Nur weil ich ein Foto von seinem Güllegespann und flüchtenden Gänsen machte! Den genialen Tipp: meine Fahrt, mit ihm hintendran, direkt an der Polizeistation enden zu lassen, gab mir meine Frau „rettend und in höchster Not“, übers Handy. Diesen Streich hatte der Umweltsünder nicht bedacht. Doch anzunehmen, die Polizei hätte den Bauern wegen Nötigung oder des Sündenfalls, auf gefrorener Schneedecke stinkende Gülle auszubringen belangt, wäre aller Erwartung an die Staatsgewalt zuviel.
Es gibt also täglich etwas zu tun. Immer und überall wird permanent gewühlt und gebuddelt, werden Tiere vertrieben und Pflanzen ausgerottet, schießen Zugvogeljäger in letzten Refugien das lebende Inventar zu Kleinholz, mähen Bauern 5x im Jahr die Feldhasen- und Kiebitzwiesen, ebnen Politiker und Beamte den Weg. Wann hat dieser Wahnsinn mal ein Ende?
Immer stellte ich Naturschutzverbänden und Initiativen meine teils erschütternden Bilddokumente der Umweltzerstörung kostenlos zur Verfügung und diese Linie behalte ich bei. Ich beklage allerdings, dass seit der digitalen Revolution in der Fotografie und der Präsenz tausender Foren von Naturfotografen kaum ein Knipser auf die Idee kommt, das Material als Waffe gegen die Schande der Landschaftsvernichtung einzusetzen. Die Gründe liegen auf der Hand: Auch spektakuläre Tieraufnahmen dienen oft der Eitelkeit, wird „Geschäft“ mit Bildern gemacht. Systemkritik ist unbequem und immer öfter beobachte ich Fotografen, die ein Schutzgebiet nach dem anderen abklappern, ohne dass gefährdete Tiere vom so genannten Ökotourismus profitieren. Winzige Restbiotope in „verlorenen Paradiesen“ unter Dauerstress.Wie angedeutet: noch nie waren die technischen und medialen Möglichkeiten der Fotografie und des Internets so gewaltig- das Entkommen aus der Medien-Zentralisierung und das „Gegensteuern“ mit „Widerstand“ so einfach.
Mehr Politik wagen! Unsere Demokratie lebt schließlich vom Widerspruch reformbedürftiger Traditionen und Rituale! Und Horst Stern verhalf dem Naturschutzgedanken zum Durchbruch! Ja- „Erreichtes“, kann aber genauso schnell „den Bach“ hinunter gehen!
Der Umweltpreis der Karl Kaus Stiftung ist die größte Würdigung meiner bescheidenen Arbeit, die ich jemals erfahren habe. Er wird ein Ansporn sein, die Mitarbeit im Wattenrat-Ostfriesland, der Gänsewacht und anderen Initiativen konsequent fortzusetzen.
Dank an folgende Mitstreiter:
Ohne die große Unterstützung vieler Gänsefreunde vor Ort, dem Wattenrat mit Manfred Knake, den „Dyklopers“ e.V., dem Tierschutzverein „Bunte Kuh“ ,den Vorstandsmitgliedern des Ökologischen Jagdverbandes Niedersachsen und meiner Familie, hätte ich den knüppeldicken Zoff mit Zugvogelschießern auf öffentlicher Bühne, zwischen „Schlickwatt und Gerichtssaal“, kaum durchgestanden. Dank der „Karl Kaus-Stiftung“ für das Vertrauen und die hohe Anerkennung, die Arbeit der Gänsewacht an Ems und Dollart so grandios zu belohnen.
Herzlichen Dank.