
Mühlenschrott nach Orkan – Foto (C): Manfred Knake
Winterstürme, Windstrom und der deutsche Journalismus
Gastbeitrag von Wolfgang Epple
Soziologen, Volkswirte und Journalisten haben das Sagen und das Schreiben, wenn es um die Zukunft unseres Landes geht. Annette Beutler z.B. schreibt für die „Zeit“. Aus Anlass eines „Windstromrekordes“, ausgelöst durch den Wintersturm „Sabine“, der am 10. Februar 2020 über das Land zog, hat sie am 21. Februar 2020 eines der vielen Zeichen für das Elend der Berichterstattung zur sogenannten Energiewende geliefert.
In scheinbar gründliche Recherche gepackt bringt sie zunächst, wenn auch abgemildert, den erkennbaren Irrsinn der Energiewende auf den Punkt: Teurer Geisterstrom, Negativ-Preise an der Strombörse, Entschädigung für nicht produzierten Strom, Redispatch und Netzstabilitätsprobleme… Scheinbar gründlich sei aus dem Artikel belegt: Man lässt sich schließlich inspirieren von der „Denkfabrik“ Agora Energiewende und den Äußerungen der Windkraftbranche, und kolportiert große Teile der dortigen Wunschlisten.
Für die Botschaft muss jedoch genauer und zwischen den Zeilen gelesen werden: Kritiker der zum Scheitern verurteilten Energiewende und speziell der Windkraft fasst Frau Beutler zusammen unter dem Begriff „Klimaschutzgegner“. Im Zeichen der notorischen Diffamierung von Kritik an der Energiewende ist der Kunstgriff der diffusen Gleichsetzung inzwischen erprobtes Handwerkszeug der Energiewende-Begleitschreiber. Windkraftkritik kann niedergemacht werden: Windkraft ist gleich Klimaschutz; Kritik an der Windkraft ist gleich Gegnerschaft der Weltrettung.
Auch für die „Zeit“-Schreiberin ist neben dem heftig beklagten Erliegen des Ausbaus der Windkraft weiterer Dreh- und Angelpunkt der scheiternden Energiewende der „schleppende Netzausbau in Deutschland“. Es wird suggeriert, dass man ansonsten alles schon im Griff hätte. Die Schlagworte sind klangvoll: Demand-Side-Management-, Smard-Grid, Power-to-Gas, Sektorenkopplung und E-Mobilität…
Einverstanden – Soziologen oder Volkswirte müssen nichts verstehen von Naturwissenschaft, speziell von Physik, Energiespeicherung oder Großwetterlagen. Dennoch sollte man voraussetzen, dass allmählich bis in die Schreibstuben der Energiewende-begeisterten Eliten angekommen sein müsste, warum sich der bejubelte Spitzenstrom aus extremen Sturmereignissen selbst dann, wenn er munter von Nord nach irgendwo transportiert werden könnte, schlecht verstetigen und auf „ein Jahr lang“ strecken lässt, zur „Versorgung“ tausender Haushalte. Denn das suggerieren die Milchmädchenrechungen zum „nicht produzierten Strom“, die von der Zeit-Autorin transportiert werden: 210 GW, abgeregelt von Tennet, „alles andere als Peanuts“, schreibt sie, denn damit „ könnten 60.000 Haushalte, eine ganze Stadt, ein Jahr lang ihren kompletten Bedarf decken.“
Die „Versorgung“ von tausenden Haushalten“, ewig wiederkehrender Fake der Windkraftbranche. Die Wahrheit würde wehtun und wird nicht berichtet (siehe Literaturhinweis): Nichts trägt die Windkraft bei zur Versorgungssicherheit. Und das europaweit. Der Hinweis auf „Dutzende Projekte in ganz Deutschland“ ist ein weiteres Suggestiv, das unbedarften Lesern vermitteln soll, die Lösung der Speicherproblematik stünde unmittelbar bevor. Gesamtzahlen zur Primärenergie, Größenordnungen und Effizienz, Flächenausbeute oder Wirkungsgrade spielen in dieser Form der Energiewende-Berichterstattung schon lange keine Rolle mehr. Erst recht nicht die Kollateralschäden für Mensch und Natur.

Kollateralschaden: Tote Fledermaus im Windpark Utgast, LK Wittmund/NDS, eine von hunderttausenden, die jährlich durch Windkraftanlagen umkommen. – Foto (C): Manfred Knake
Im Gegensatz zu den 100-%-Erneuerbaren-Utopien ist Fakt und – allerdings nicht unbedingt bei der „Zeit“ – nachlesbar: Ganz Deutschland wird in den Planspielen der Energiewende zur „Energielandschaft“ umgebaut und degradiert, zugestellt mit einer gegenüber heute (30 000 WEA) voraussichtlich versechsfachten Zahl von Windkraftanlagen. Physische Grenzen – auch die dichte Bebauung unseres Landes und das schon heute weit überstrapazierte und sehr begrenzte Naturkapital – keiner Rede wert.
Die monatelangen Schwachwindwetterlagen des vergangenen Winters über großen Teilen Mittel- und Süd-Europas waren für Elite-Journalisten der Marke „Zeit“ oder des unten zur Ehre kommenden BR kein Thema in Sachen Energiewende. Da hört und sieht man nichts von den (ausbleibenden) Windstromsegnungen, die – Sturm Sabine hat’s angeblich bewiesen – so und so viele Tausend Haushalte mit Strom versorgen könnten, hätte man doch wenigstens die Leitungen von Nord nach Süd.
Gerade das hat Methode: Bei Sturmereignissen melden sich die Energiewende-Propheten und Windkraft-Profiteure regelmäßig zu Wort mit Rekorden und satteln Forderungen und Behauptungen auf, die der zahlende Bürger ohnehin nicht verstehen kann, und also zu glauben hat.
Aber keine Bange: Die „Zeit“ wird im Verein mit anderen Elite-Medien die Umwandlung Deutschlands in das Energiewendewunderland kritisch und sorgfältig recherchierend begleiten. Diejenigen, die fundiert Einspruch erheben gegen die Vernichtung von Natur und Landschaft, gegen das Verbrennen von Volksvermögen (siehe Nachtrag), erprobter Infrastruktur und effizienter Technik werden als „Klimaschutzgegner“ einfach platt gemacht.
Die Energiewende-schön-schreibende Zunft hat wirkmächtige Unterstützung aus den Funkhäusern der öffentlich-rechtlichen Medienanstalten: Seit Monaten ein Trommelfeuer zum jammervollen Niedergang der Windkraftbranche, zum Einhalten der Klimaziele nur über massiven Ausbau der Windkraft, zur angeblichen Verhinderung der Weltrettung durch uneinsichtige Bürger, die den Naturschutz missbrauchen und sowieso größtenteils bei der AfD anzusiedeln sind.
Unter zig öffentlich-rechtlichen Tendenz-Beiträgen der letzten Wochen und Monate sei ein aktuelles Filmchen des BR herausgegriffen, das am 12. März 2020 ausgestrahlt wurde. Der Titel vielsagend und zunächst ganz harmlos fragend: „Wende bei der Wende? Warum klappt das nicht so richtig mit den alternativen Energien?“ Was folgt, ist geschickt aufgemachte Propaganda, perfekt inszeniert mit den Wortmeldungen des scheidenden Bürgermeisters aus Bernried am Starnberger See, der mit „kleinen Veränderungen“ Bernried „unabhängig von den großen Versorgern machen wollte“, und dann doch durch die 10-H-Regelung ausgebremst wurde („des war alles ummasonst“, Minunte 1.10 des Beitrages).
Der BR lässt einfließen, und schickt aus dem aus dem off mit sanfter Frauenstimme: „Der Wunsch nach mehr erneuerbaren Energien ist da, bei Bürgern wie Bürgermeistern…“. Bestätigen und erklären darf dies der Vertreter der „Bürgerstiftung Energiewende Oberland“, Andreas Scharli, der das „leidige am Thema Klimaschutz“ (ab Minute 1.40 des Beitrages) mit einem krudem Kommentar zur Rechtslage garniert; Hauptdefizit aus solcher vom BR nicht hinterfragter Sicht: “dass wir gesetzlich no koa Verankerung hab’n“…Es folgt ein rechtssystematisch völlig abwegiger Vergleich mit dem „Brandschutz auf Berghütten“.

Von Schleswig- Holstein bis Bayern: Neue deutsche Landschaften. Hier: Blick in die Gemeinde Dornum/LK Aurich/Niedersachsen – Foto (C): Peter Gauditz
Dem letzten BR-konsumierenden Bayern müsste endlich klar werden, was uns dieser Energieberater und Lobbyist nun beibringt: „(…) nur der Klimaschutz ist nicht gesetzlich verankert. Ich hab‘ da keine Handhabe“. Dazu springt nun der der BR in die Bresche (ab Min. 2.00 des Beitrags): „Ganz im Gegenteil: Seit 2014 gibt es in Bayern auch noch die Abstandsregelung 10-H.“ Was folgt, ist das obligatorische Horst-Seehofer-Bashing, dessen fundierter Einspruch gegen die „Verspargelung“ Bayerns vom BR geschickt lächerlich gemacht wird. „(…) seitdem ist der Ausbau der Windkraft fast zum Erliegen gekommen“, schließt der sanft-weibliche Propagandaton aus dem BR-Off, nicht ohne den Hinweis, dass auch „viele „Fachleute“ das Ende von 10-H fordern“. Dem BR ist die Kehrseite der Energiewende- und Windkraft-Medaille in jeder Hinsicht kein Wort wert. In dieser Kurzfassung genau drei Minuten gebührenfinanzierte – durchaus gekonnte – Propaganda und einseitige Stimmung-Mache, die sowohl Bildungsauftrag als auch Neutralitätsverpflichtung aus dem Rundfunkstaatsvertrag mit Füßen tritt. Leider erfährt man über die Autorin dieses BR-Machwerkes, Viola Nowak, im Internet so gut wie nichts. Man hätte gerne gewusst, wo sie ihre journalistische Ausbildung absolvierte. Zum Thema wird man jedoch noch mal fündig. Es gibt eine Langfassung des Propaganda-Beitrages – ab Min. 4.45 dieses Beitrages wird ein weiterer Windkraft-Held durch den BR aufgebaut: der Noch-Bürgermeister der Gemeinde Berg am Starnberger See.
Die Kritik an den dort aufgestellten Windkraftanlagen verbucht die BR-Autorin unter „Hass und Hetze“, der Bürgerwindpark und die „lokale Wertschöpfung“ hingegen werden gepriesen. Dass Windkraft keinen Beitrag zur Versorgungsicherheit leistet, weiß Frau Nowak nicht – oder sie verschweigt es, wie praktisch alle ÖR-Beiträge dies notorisch tun. Die Einseitigkeit des Beitrages gipfelt in der Aussage. „Mittlerweile sind die Windräder akzeptiert“. Von wem bitteschön? Man möchte gerne fragen: Wen haben Sie befragt? Das Schluss-Suggestiv, das der BR verabreicht: Es wird suggeriert, dass die Bayerische Staatsregierung kein eindeutiges Bekenntnis zur Energiewende abgegeben hat; und nicht nur der Bürgermeister aus Bernried hofft für den Windkraftausbau in Bayern, „dass es bald eine „verlässliche Grundlage geben wird“. 10-H ist dies offensichtlich nicht für den öffentlich-rechtlichen Sender. Da ignoriert man öffentlich-rechtlich bewusst, dass diese Regelung beim bayrischen Verfassungsgerichtshof höchstrichterlich bereits seit 2016 bestätigt ist. Wenn es um Windkraft geht, ist geltendes Recht ganz offensichtlich lästig.

Nur wenige hundert Meter bis zum Dorf: Windkraft an der Kirche in Roggenstede/Gemeinde Dornum/LK Aurich – Foto: privat
Einseitigkeit, gepaart mit Ausblenden wesentlicher Fakten, und Kolportage von Propaganda: Dieser Dreiklang dominiert inzwischen in einer solchen Penetranz das deutsche Energiewende-Mediengeschäft, dass kritische Würdigung und dokumentarisches Festhalten solcher Fehlleistungen zu Pflichten mündiger Bürger werden. Zur beklemmenden Begleiterscheinung der deutschen Energiewende jedenfalls gehört inzwischen greifbar und belegbar der Niedergang des Journalismus.
Literaturempfehlung zur mangelnden Versorgunssicherheit durch Windkraft:
a) Linnemann, Th.; Vallana, G. S.: Windener gie in Deutschland und Europa: Status quo, Potenziale und Herausforderungen in der Grundversorgung mit Elektrizität, Teil 1:Entwicklungen in Deutschland seit dem Jahr 2010. VGB PowerTech 97 (2017), Nr. 6, S. 63-73.
Zur Person:
Wolfgang Epple ist seit rund 50 Jahren ehren- und hauptamtlich im Umwelt- und Naturschutz aktiv.
Der promovierte Zoologe und Evolutionsbiologe war viele Jahre wissenschaftlicher Mitarbeiter und später Landesgeschäftsführer Baden-Württemberg des NABU (vormals Deutscher Bund für Vogelschutz e.V.).
—
Dieser Beitrag erschien zuerst am 17. März 2020 beim Umwelt-Watchblog
Die Fotos in dieser Veröffentlichung wurden vom Wattenrat eingefügt. Wir danken Herrn Dr. Epple für die freundliche Übernahmegenehmigung.
Der Beitrag Gastbeitrag: Winterstürme, Windstrom und der deutsche Journalismus erschien zuerst auf Wattenrat Ostfriesland.


























 Im Mai 2020 unterzeichneten der Ministerpräsident, Umwelt- und Landwirtschaftsminister, die Präsidenten von Landvolk und Landwirtschaftskammer und die Vorsitzenden von BUND und NABU Niedersachsen eine als „Maßnahmenpaket für den Natur-, Arten- und Gewässerschutz“ bezeichnete Vereinbarung zwischen Land, Landwirtschaft und Umweltverbänden. „Der Niedersächsische Weg“, so bezeichnen die Unterzeichner die knapp zehn Seiten Text – mutmaßlich in Abgrenzung zu einem Bayerischen Weg. In
Im Mai 2020 unterzeichneten der Ministerpräsident, Umwelt- und Landwirtschaftsminister, die Präsidenten von Landvolk und Landwirtschaftskammer und die Vorsitzenden von BUND und NABU Niedersachsen eine als „Maßnahmenpaket für den Natur-, Arten- und Gewässerschutz“ bezeichnete Vereinbarung zwischen Land, Landwirtschaft und Umweltverbänden. „Der Niedersächsische Weg“, so bezeichnen die Unterzeichner die knapp zehn Seiten Text – mutmaßlich in Abgrenzung zu einem Bayerischen Weg. In 





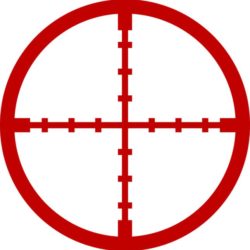 Für Eingriffe in Natur und Landschaft im Verantwortungsbereich des Bundes gilt ab sofort eine Bundeskompensationsverordnung (BKompV), die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Kompensation) bei Eingriffen regelt. Dadurch soll die Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung länderübergreifend in allen Bundesländern standardisiert werden. Besonders das Bundeslandwirtschaftsministerium legte Wert darauf, dass land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Belange in der BKompV berücksichtigt werden. „Durch die Verordnung werden die Anforderungen im Rahmen der gesetzlich bestehenden Verpflichtungen zur Vermeidung und Kompensation von Beeinträchtigungen bei Eingriffen in Natur und Landschaft weiter konkretisiert und bundesweit standardisiert […] Dabei wird die Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung länderübergreifend vereinheitlicht und insgesamt transparenter und effektiver gestaltet “, verlautete es bereits ganz harmlos im April 2020 aus dem Bundesumweltministerium:
Für Eingriffe in Natur und Landschaft im Verantwortungsbereich des Bundes gilt ab sofort eine Bundeskompensationsverordnung (BKompV), die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Kompensation) bei Eingriffen regelt. Dadurch soll die Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung länderübergreifend in allen Bundesländern standardisiert werden. Besonders das Bundeslandwirtschaftsministerium legte Wert darauf, dass land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Belange in der BKompV berücksichtigt werden. „Durch die Verordnung werden die Anforderungen im Rahmen der gesetzlich bestehenden Verpflichtungen zur Vermeidung und Kompensation von Beeinträchtigungen bei Eingriffen in Natur und Landschaft weiter konkretisiert und bundesweit standardisiert […] Dabei wird die Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung länderübergreifend vereinheitlicht und insgesamt transparenter und effektiver gestaltet “, verlautete es bereits ganz harmlos im April 2020 aus dem Bundesumweltministerium: 


 Über Schafsköpfe
Über Schafsköpfe



