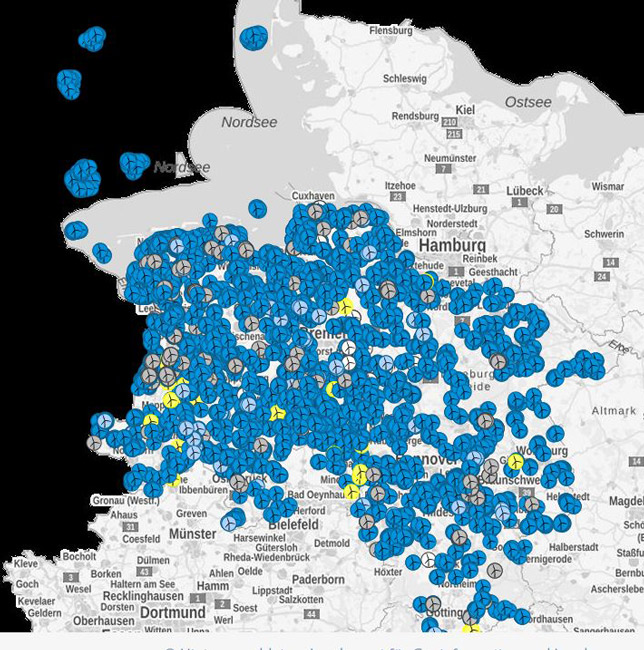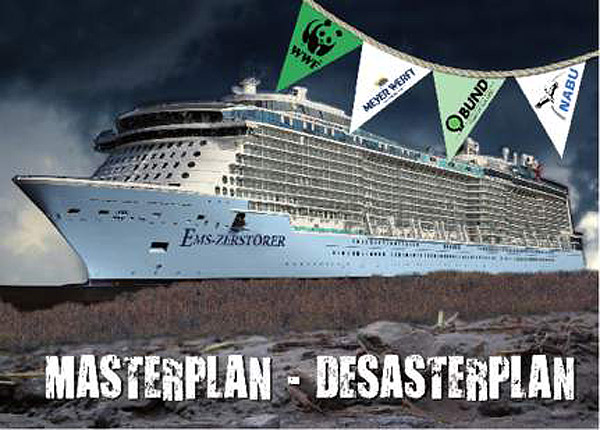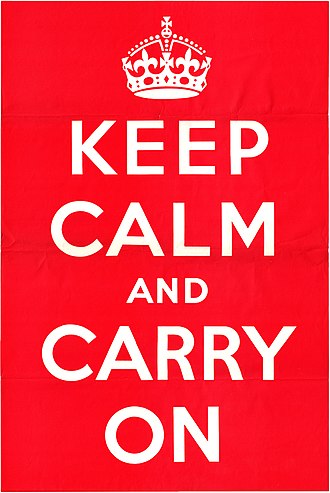Karbidschießen mit zwei „Geschützen“ am Emsdeich bei Pogum/LK Leer, in unmittelbarer Nähe der strengsten Schutzzone des Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer und des NSG „Unterems“, 31. Dez. 2018 – Foto: privat
Einen späten Nachhall hatte das vom Wattenrat angezeigte sehr laute Karbidschießen aus selbstgebastelten „Geschützen“ am Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer an Silvester 2018. Die Zeitung „Der Wecker“, die einmal wöchentlich im gesamten Landkreis Leer und in den Gemeinden Barßel und Saterland im Nordkreis Cloppenburg erscheint, griff das Thema ein Jahr später noch einmal auf (siehe unten). Nur hat sich in der Sache bisher wenig getan, sie ist sozusagen im Sande der Behörden verlaufen. So richtig zuständig fühlt sich nach einem Jahr der Anzeigenerstattung durch den Wattenrat wohl niemand.
Einer schiebt es auf den anderen. Der Landkreis Leer eiert. Die Polizei hatte Anfang des Jahres 2019 Zeugen befragt und „Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet“. Es sollte „intern geklärt werden“, wie die „Rechtsgrundlage“ sei (siehe Rheiderland Zeitung vom 21. Jan. 2019). Das müsste doch nun langsam geklärt worden sein, klingt aber nicht so. Es klingt mehr nach „ausgesessen“ als nach „geklärt“.
Das Waffengesetz führt aus:
Waffengesetz (WaffG), Anlage 2 (zu § 2 Abs. 2 bis 4)
Waffenliste
(Fundstelle: BGBl. I 2002, 3999 – 4002;
„Verbotene Waffen
Der Umgang mit folgenden Waffen und Munition ist verboten:
[…]
1.3.4
Gegenstände, bei denen leicht entflammbare Stoffe so verteilt und
entzündet werden, dass schlagartig ein Brand entstehen kann; oder in
denen unter Verwendung explosionsgefährlicher oder explosionsfähiger
Stoffe eine Explosion ausgelöst werden kann
[…]
1.5.5
Knallkartuschen, Reiz- und sonstige Wirkstoffmunition nach Tabelle 5 der Maßtafeln nach § 1 Abs. 3 Satz 3 der Dritten Verordnung zum Waffengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. September 1991 (BGBl. I S. 1872), die zuletzt durch die Zweite Verordnung zur Änderung von waffenrechtlichen Verordnungen vom 24. Januar 2000 (BGBl.I S. 38) geändert wurde, in der jeweils geltenden Fassung (Maßtafeln), bei deren Verschießen in Entfernungen von mehr als 1,5 m vor der Mündung Verletzungen durch feste Bestandteile hervorgerufen werden können, ausgenommen Kartuschenmunition der Kaliber 16 und 12 mit einer Hülsenlänge von nicht mehr als 47 oder 49 mm;[…]“
Welche enorme Wucht beim Karbidschießen entstehen kann, zeigt das Video aus den Niederlanden: hier
Verstöße gegen das Waffengesetz sind eine Straftat. Es werden beim Karbidschießen feste Bestandteile in einer Entfernung von mehr als 1,5 Metern verschossen, und das aus sehr großen selbstgebauten Kalibern. Das Bundesnaturschutzgesetz verbietet das mutwillige Beunruhigen von Tieren (§39) als Ordnungswidrigkeit, egal ob Schutzgebiet oder nicht. Gerade Rastvögel reagieren sehr empfindlich auf plötzliche und laute Knallgeräusche mit panikartiger Flucht. Wo ist da die „Grauzone? Es fehlt wohl wieder einmal der Wille, Gesetze auch anzuwenden und vor allem gegen evtl. öffentliche Aufschreie durchzusetzen (nach dem Motto: „dat hebbt wie immer so makt, dat makt wi ok wieder so“). Das alte Lied des viel beklagten „Vollzugsdefizits“, gerade bei Verstößen gegen Naturschutzvogaben.
Der Wecker, Zeitungsgruppe Ostfriesland (ZGO), Leer, 28./29. Dez. 2019
Karbid-Schießen in Grauzone
Um böse Geister zu vertreiben, wird zu Silvester vielerorts geböllert und farbiges Feuerwerk entzündet. In Ostfriesland gibt es eine besonders laute Tradition: das Karbid-Schießen. Das ist sehr umstritten.Von Doris Zuidema
LANDKREISE LEER/ CLOPPENBURG – In Deutschland wird zu Silvester fast überall geböllert. Mit farbigem Feuerwerk und lautem Geknalle sollen böse Geister vertrieben werden. Was das laute Geknalle angeht, gibt es in den Landkreisen Leer und Cloppenburg noch eine weitere Tradition: Das Karbid-Schießen. Dabei wird Karbid in Stahl-Milchkannen zur Explosion gebracht. Die aufgesteckten Kannendeckel werden dadurch mit lautem Knall in hohem Bogen bis zu 100 Meter weit geschleudert.
Doch dieser Brauch ist umstritten. So hatte es im vergangenen Jahr Ärger um diese Tradition, unter anderem in Backemoor (Gemeinde Rhauderfehn) und in Pogum (Gemeinde Jemgum) gegeben. In Backemoor hatten sich Anwohner über den Lärm beschwert, in Pogum hatte die Schießerei die Naturschützer auf den Plan gerufen.
In Backemoor ist das Karbid-Schießen in diesem Jahr abgesagt. Ortsbürgermeister Bernhard Bünnemeyer ist aber zuversichtlich, dass es Silvester 2020 wieder stattfinden kann. „Wir suchen einen neuen Platz dafür“, so Bünnemeyer.
Beim Karbid-Schießen in Pogum hatte Naturschützer Manfred Knake aus Holtgast (Landkreis Wittmund) vom Wattenrat Ostfriesland vor allem kritisiert, dass das Geschütz in Richtung Salzwiesen, der strengsten Schutzzone des Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer, ausgerichtet worden war. Er hatte sich sogar an die Polizei gewandt.
Die rechtliche Lage beim Karbid-Schießen bleibt aber nebulös.
Der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) in Norden wertet „das außerordentlich laute Karbid-Schießen in der Nähe eines Schutzgebietes als erhebliche Störung“. Allerdings sei es in der Verordnung für Naturschutzgebiete nicht ausdrücklich untersagt. „Jedes panische und unorganisierte Auffliegen verursacht bei Wildgänsen, Wildenten und Watvögeln einen Verlust von Energiereserven, die ja gerade in der Zeit der Überwinterung und Vorbereitung auf die nächste Zug-und Brutzeit von besonderer Bedeutung sind“, gab Heinrich Pegel von der NLWKN-eigenen Naturschutzstation Ems in Moormerland zu bedenken. Für konkrete behördliche Maßnahmen sei aber der Landkreis Leer zuständig, hieß es vonseiten des niedersächsischen Landesbetriebes.
Philipp Koenen, Sprecher des Landkreises Leer, erläuterte: „Ob das Karbid-Schießen rechtlich zulässig ist, hängt davon ab, wo es stattfindet. Dabei können das Naturschutzrecht oder das Deichrecht eine Rolle spielen.“ Das wiederum müsse von den Kommunen geprüft werden. „Da spezielle Regelungen – etwa nach dem Sprengstoff- und Waffengesetz – hier keine Anwendung finden, ist der Landkreis nicht zuständig“, so Koenen. Wie Jemgums Bürgermeister Hans-Peter Heikens mitteilte, liegt der Gemeinde Jemgum kein Antrag für ein Karbid-Schießen zu Silvester in Pogum vor. Allerdings sei bei der Gemeinde noch nie ein Antrag eingereicht und dementsprechend auch noch nie ein Karbid-Schießen genehmigt worden. „Bei dieser Linie werden wir bleiben“, so Heikens. Ob in Pogum ein Karbid-Schießen stattfindet, ist ungewiss.
Wer auf Kanonenschläge zu Silvester nicht verzichten mag, kann anderenorts dabei Zusehen, wie die bösen Geister mittels einer Stahl-Milchkanne oder einer Kanone vertrieben werden: In Filsum (Samtgemeinde Jümme) findet am Silvestertag das Karbid-Schießen auf dem Sportplatz in Filsum statt. Ausrichter ist der Bürgerverein. In Holtland (Gemeinde Hesel) gibt es am 31. Dezember zwischen 13 und 16 Uhr ein Karbid-Schießen bei der Mühle. In Wittensand (Kreis Cloppenburg) feuert der Heimat-und Böllerverein „Widerhall“ Punkt Mitternacht seine Böllerkanone mit einem Gas-Sauerstoff-Gemisch ab. Probleme habe es noch nie gegeben, sagte Vereinssprecher Andre Waden. „Wir schießen fünf, sechs Mal. Alle Anwohner sind dann beim Kreuz in Wittensand versammelt, trinken ein Gläschen Sekt, unterhalten sich noch etwas, und um halb eins ist das Spektakel dann wieder beendet.“
Der Beitrag Karbidschießen: nichts Genaues weiß man nicht erschien zuerst auf Wattenrat Ostfriesland.