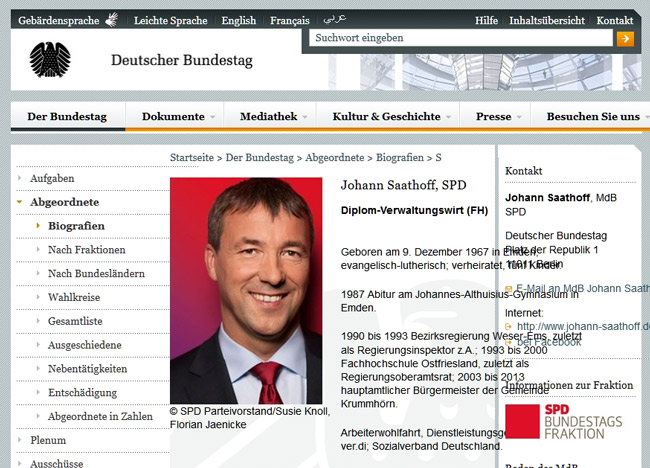![Peter_Turz_2016]()
(C): Peter Turz, 26427 Holtgast, http://www.peter-turz.de. Die Handlung und alle handelnden Personen auf dem Bild sind frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeit mit den Praktiken lebender Personen wäre rein zufällig, ist weder beabsichtigt noch zufällig, sondern unvermeidlich…
In der Samtgemeinde Esens/LK Wittmund/NDS häufen sich die Beschwerden über zu viele und zu laute Windkraftanlagen. Bereits im Dezember 2015 wurde auf einer Samtgemeinderatssitzung in Esens von der CDU-FDP-Gruppe im Samtgemeinderat vergeblich versucht, die Abstimmung über eine vorgesehene Bürgerbefragung zu mehr oder weniger Windenergie zu verhindern. Die CDU-FDP-Gruppe wurde von der Gruppe SPD-Grüne und der Esenser Bürgerinitiative (EBI) für eine Bürgerbefragung überstimmt. Die Befragung ist inzwischen angelaufen und endet am 02. Februar 2016 (.pdf: Buergerbefragung_WEA_Esens).
Das hatte Folgen: Nun versuchen Ratsmitglieder aus der Mitgliedsgemeinde Stedesdorf und ein Stedesdorfer Bürger aus dem Windenergielager die Bürgerbefragung auf anderem Wege, sogar gerichtlich, zu torpedieren. In der Mitgliedsgemeinde Stedesdorf wird ein Windpark unter Beteiligung des Ortsbürgermeisters Oelrichs (Vorsitzender des Aufsichtsrates „Bürgerwindpark Stedesdorf eG“) und mehrerer Ratsmitglieder betrieben und soll um weitere 5 Anlagen „verdichtet“ werden. Das könnte durch einen Samtgemeinderatsbeschluss zur Änderung des Flächennutzungsplanes zur Einfrierung der Windenergieanlagen, der sich auf die Bürgerbefragung stützen könnte, verhindert werden. Die Gemeinde Stedesdorf wollte die Bürgerbefragung bereits durch den Landkreis Wittmund stoppen lassen, vergeblich. Nun legte ein an der Windkraft familiär beteiligter Stedesdorfer Bürger nach. Er will die Bürgerbefragung durch das Verwaltungsgericht Oldenburg verhindern. Nach Recherchen des Wattenrates soll es sich um den Sohn des Esenser Samtgemeinderatsmitgliedes Hugo Baack (CDU) handeln; dieser Esenser Kommunalpolitiker ist ebenfalls im Vorstand der „Bürgerwindpark Stedesdorf eG“ tätig.
Laut hier vorliegenden Handelsregisterauszügen „Grundstückseigentümer Stedesdorf GmbH & Co KG“, (Aurich HRB 201093) ist u.a. Hugo Baack mit beträchtlichen Summen im sechsstelligen Bereich an Grundstücken im Windpark Stedesdorf beteiligt, zusätzlich mit einer kleinen Summe als Gesellschafter in der „Bürgerwindpark Stedesdorf Beteiligungs GmbH“ (Aurich HRB 201325). Im „Bürgerwindpark Repowering Stedesdorf GmbH & Co KG“ (Aurich HRA 201344) – da geht es um die „Verdichtung“ des Windparks mit fünf weiteren Anlagen – ist Hugo Baack ebenfalls mit einer Einlage im sechsstelligen Bereich beteiligt. Er ist zusätzlich in der „Bürgerwindpark Stedesdorf Komplementär GmbH“ (Aurich HRB 202058) mit einem großen Beitrag dabei. In dieser Komplementär GmbH sind weitere 5 Gesellschafter vertreten, die laut Eintrag nicht namentlich genannt werden wollen.
![Stedesdorf/Samtgemeinde Esens/LK Wittmund/NDS: Hier stehen derzeit insgensamt zehn Windkraftanlagen,fünf weitere solen noch hinzukommen]()
Stedesdorf/Samtgemeinde Esens/LK Wittmund/NDS: Hier stehen derzeit insgesamt zehn Windkraftanlagen,fünf weitere sollen noch hinzukommen. Foto (C): Manfred Knake
Ein weiteres Ratsmitglied in Stedesdorf und im Samtgemeinderat Esens, Menno Krey (SPD), ist gerade aus der Partei ausgetreten. Die Esenser SPD hatte ihm vorgehalten, sie nicht über die weiteren Windkraft- „Verdichtungspläne“ in der Gemeinde Stedesdorf informiert und so „getäuscht“ zu haben. Krey soll aus der Samtgemeinderatsfraktion ausgeschlossen werden. Er ist auch zweiter stellvertretender Bügermeister der Samtgemeinde Esens. Nach seinem Fraktionsrauswurf will er aber sein Mandat in der Samtgemeinde behalten.
![Windparks Utgast, LK Wittmund/NDS am EU-Vogelschutzgebiet "Ostfriesische Seemarschen Norden bis Esens", Foto (C): Manfred Knake]()
Windparks Utgast, Gemeinde Holtgast, LK Wittmund/NDS, am EU-Vogelschutzgebiet „Ostfriesische Seemarschen Norden bis Esens“, Foto (C): Manfred Knake
Auch in der Esenser Mitgliedsgemeinde Holtgast unterstützt der Bürgermeister Enno Ihnen (CDU) ein „Repowering“ mit größeren und lauteren Anlagen, direkt an einem Vogelschutzgebiet, in dem schon die Umgehungsstraße Bensersiel illegal gebaut wurde. Bürgermeister Ihnen stimmte ebenfalls auf der Ratssitzung im Dezember 2015 gegen eine Bürgerbefragung. Er ist Vorsitzender des Bau- und Umweltausschusses der Samtgemeinde Esens. Der Sohn seiner Lebensgefährtin hat ebenfalls eine beträchtliche Einlage als Kommanditist bei den Grundstückseigentümern des Windparks Stedesdorf (Aurich HRB 201093) geleistet.
Jetzt weiß man, woher der Wind bei diesen „Volksvertretern“ weht! Es geht ums Geld, ums eigene dieser Kommunalpolitiker und das der Stromkunden, das zwangsweise aus dem Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) mit der Stromrechnung eingezogen wird und die Gelddruckmaschine Windenergie für die Betreiber „wie geschmiert“ am Laufen hält. Das EEG und die Begehrlichkeiten auch von Kommunalpolitikern lässt Windkraftanlagen aus dem (fast) unsichtbaren Geflecht auch der kommunalen Profiteure wie Pilze aus dem Boden schießen.
—-
Anzeiger für Harlingerland, Wittmund/NDS, S.1, 21. Januar 2016
Gericht soll Befragung stoppen
WINDENERGIE Samtgemeinde „erstaunt“ – Landkreis sieht keinen Handlungsbedarf
Die Bürgerbefragung zur Windenergienutzung in der Samtgemeinde Esens läuft. Mehr als die Hälfte hat schon abgestimmt.
ESENS/STEDESDORF/HÄ – Der Wettlauf zwischen der Gemeinde und den Betreibern des Windparks Stedesdorf auf der einen und der Samtgemeinde Esens auf der anderen Seite erreicht einen neuen Höhepunkt: Während in der Samtgemeinde eine Bürgerbefragung zum Thema Windenergienutzung läuft und sich daran bereits 50 Prozent der Bürger aus allen Mitgliedsgemeinden beteiligt haben, kommen die Gemeinde Stedesdorf sowie ein einzelner familiär betroffener Bürger – geplant ist eine Verdichtung mit fünf weiteren Anlagen – offensichtlich unter Druck. In einem Antrag an den Landkreis Wittmund hat zunächst die Gemeinde Stedesdorf versucht, die Bürgerbefragung stoppen und die Auswertung unterbinden zu lassen. Seit Dienstag liegt dem Verwaltungsgericht in Oldenburg darüber hinaus ein gleichgearteter Antrag eines Stedesdorfers vor. Das Gericht möge die im Rat der Samtgemeinde Esens beschlossene Bürgerbefragung stoppen und die Auswertung unterbinden, so das Ziel. Das bestätigt Samtgemeindebürgermeister Harald Hinrichs auf Nachfrage. Der Landkreis Wittmund habe den Antrag geprüft. „Im Ergebnis hat er keinen kommunalrechtlichen Anlass gesehen einzuschreiten. Der Landkreis Wittmund hat dem Antrag der Gemeinde Stedesdorf nicht entsprochen.“ Was das Verwaltungsgericht angehe, so sei die Samtgemeinde um Stellungnahme gebeten worden. „Dem werden wir umgehend nachkommen“, so Hinrichs. Die Befragung zur Windenergienutzung sei die erste Bürgerbefragung in der Samtgemeinde überhaupt. Der Rücklauf von bisher 50 Prozent zeige, dass das Thema die Menschen bewege. Seite 4
—
Seite 4
Kreis weist Stedesdorfer Ansinnen zurück
BÜRGERBEFRAGUNG Samtgemeinde „erstaunt“ über Eingaben an den Kreis und das Verwaltungsgericht
Die Windenergienutzung bewegt die Menschen. Das zeigt der bisher hohe Rücklauf der laufenden Bürgerbefragung.
ESENS/WITTMUND/OLDENBURG/ HÄ/MH – In der letzten Sitzung des Samtgemeinderates Esens haben dessen Mitglieder beschlossen, per Bürgerbefragung zu ermitteln, wie die Menschen in der Samtgemeinde Esens zum Stand der Windenergienutzung stehen. Ist in der Samtgemeinde Esens eine Grenze erreicht oder sollen weitere Windenergieanlagen gebaut werden? Das ist die Frage an die Bürger aller Mitgliedsgemeinden. Wie Samtgemeindebürgermeister Harald Hinrichs auf Nachfrage des HARLINGER erklärt, haben zur Halbzeit der Bürgerbefragung – sie endet am 2. Februar – bereits mehr als 50 Prozent der Einwohner der Samtgemeinde an der Bürgerbefragung teilgenommen und mit ihrer Stimme ihre Meinung kundgetan. „Es ist die erste Bürgerbefragung in der Samtgemeinde Esens überhaupt. Und der hohe Rücklauf zeigt, dass das Thema die Menschen bewegt“, so Harald Hinrichs. Umso erstaunter sei er gewesen, dass zunächst die Gemeinde Stedesdorf versucht hat, die Bürgerbefragung und Auswertung per Eingabe an den Landkreis Wittmund stoppen und verhindern zu lassen. Der Landkreis hat diesen Antrag abgelehnt.
Für noch größeres Erstaunen habe ein zusätzlicher, gleichlautender Antrag eines familiär beteiligten Stedesdorfers an das Verwaltungsgericht in Oldenburg gesorgt. „Auch dort wird nun geprüft. Das Verwaltungsgericht hat die Samtgemeinde bereits um eine Stellungnahme gebeten. Wie und wann es entscheiden wird, ist offen“, so Samtgemeindebürgermeister Harald Hinrichs. Er hoffe jedoch, dass die Bürgerbefragung ohne weitere Probleme fortgesetzt werden könne und dass es dann am 3. Februar auch zur Auszählung kommen werde. Vor dem Hintergrund der Eingaben aus Stedesdorf an den Landkreis Wittmund und das Verwaltungsgericht erklärte Harald Hinrichs: „Ich würde mich freuen, wenn sich die Bürger in der noch verbleibenden Zeit weiter so zahlreich an der Befragung beteiligen wie bisher.“ Scharfe Kritik an den Stedesdorfer Anträgen kommt aus den Reihen der SPD-Samtgemeindepolitiker. In dem Versuch, die Bürgerbefragung stoppen und die Auswertung verhindern zu wollen, sehen sie das Interesse der Bürger nicht mehr vertreten und den Bürgerwillen mit Füßen getreten. Auch sie hoffen, dass sich nun erst Recht noch möglichst viele Einwohner der Samtgemeinde Esens an der Bürgerbefragung zum Thema Windenergie beteiligen. Weitere Kritik kommt vom Stedesdorfer Ratsherren Martin Jacobs. Er habe erst durch eine E-Mail von den Anträgen, von denen er sich ausdrücklich distanziert, erfahren. „Auch im Rat waren diese Anträge kein Thema. Das ist ein unhaltbarer Zustand innerhalb unserer Gemeinde.“